In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts hat die Welt viele tiefgreifende Veränderungen durchgemacht, wobei eine Reihe bewaffneter Konflikte immer komplexer und unvorhersehbarer geworden sind.
 |
| Die auf der ganzen Welt ausbrechenden Konflikte verleihen der globalen Sicherheitslage ein zunehmend düsteres Gesicht. Illustrationsfoto. (Quelle: AFP) |
Von langwierigen Bürgerkriegen im Nahen Osten und Afrika bis hin zu erbitterten Territorialstreitigkeiten in Asien und Osteuropa scheint sich die globale Sicherheitslage zunehmend zu verdunkeln. Die Terroranschläge vom 11. September schockierten nicht nur die gesamten Vereinigten Staaten, sondern leiteten auch eine neue Ära ein, in der die Grenze zwischen traditioneller Kriegsführung und nicht-traditionellen Sicherheitsbedrohungen mehr denn je verschwimmt.
In diesem Zusammenhang verändern die digitale Technologierevolution und die künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise, wie Menschen interagieren, rasant, einschließlich der Methoden von Krieg und Konflikten. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um Einfluss unter den Großmächten immer mehr und droht, die ohnehin schon wackeligen multilateralen Institutionen zu schwächen. Die Folgen dieser Konflikte sind nicht nur unmittelbare Tragödien, sondern hinterlassen auch tiefe Wunden und behindern die Bemühungen der gesamten Menschheit um eine nachhaltige Entwicklung.
Ein komplexes Bild
In den letzten beiden Jahrzehnten kam es weltweit zu mehr als 100 bewaffneten Konflikten unterschiedlichen Ausmaßes, die sich ungleichmäßig über die Regionen verteilten. Afrika erwies sich mit fast 50 Konflikten als größter Krisenherd, was etwa 40 Prozent der Gesamtzahl der Konflikte entspricht. Als nächstes folgt der Nahe Osten mit rund 30 Konflikten, während andere Regionen wie Südasien, Südostasien und Osteuropa von großen Unruhen geprägt waren.
Konflikte konzentrieren sich vor allem auf Entwicklungsländer. Der seit 2003 andauernde Bürgerkrieg im Sudan hat eine der größten humanitären Krisen der Welt ausgelöst und Millionen von Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen. Im Nahen Osten führte der 2011 begonnene syrische Bürgerkrieg zur Intervention zahlreicher Großmächte, was eine Flüchtlingswelle von über fünf Millionen Menschen auslöste und die geopolitische Landschaft der Region veränderte.
Was die Ursachen betrifft, sind politische Machtkämpfe (etwa 25 % der Fälle) und territoriale Streitigkeiten (fast 20 %) nach wie vor die beiden Hauptgründe für Konflikte. Dies zeigt sich in den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, wo Fragen der nationalen Sicherheit und territoriale Streitigkeiten eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus sind etwa 15 Prozent der Fälle auf Terrorismus zurückzuführen, wie der Kampf gegen die bewaffnete Gruppe IS im Irak und in Syrien zeigt.
In Bezug auf Ausmaß und Intensität kommen bei fast der Hälfte aller Konflikte mehr als 1.000 Menschen ums Leben. Insbesondere einige Konflikte wie der Krieg in Darfur, der irakische Bürgerkrieg und der Russland-Ukraine-Konflikt haben über 100.000 Opfer gefordert. Dies spiegelt den Trend wider, dass Konflikte immer intensiver und zerstörerischer werden, insbesondere in humanitärer Hinsicht.
Im Laufe der Zeit hat die Zahl langwieriger Konflikte zugenommen; mehr als ein Drittel dieser Konflikte sind noch immer ungelöst, manche dauern sogar schon über zehn Jahre an. Nur etwa 30 % der Konflikte enden in weniger als einem Jahr, was die zunehmende Komplexität der aktuellen Lage und die Ineffektivität internationaler Konfliktlösungsmechanismen widerspiegelt.
Und schließlich spielt die Technologie eine immer wichtigere Rolle. Die Popularität digitaler Technologien und sozialer Netzwerke hat ein günstiges Umfeld für Informationskriege geschaffen und die Verbreitung extremistischer Ideologien begünstigt. Für terroristische Gruppen sind sie zu einem wirksamen Instrument der Propaganda und der Rekrutierung von Mitgliedern geworden. Cyberangriffe kommen immer häufiger vor, wie der Russland-Ukraine-Konflikt zeigt, und eröffnen eine neue Front in der modernen Kriegsführung. Insgesamt zeichnen die Entwicklungen im Bereich der bewaffneten Konflikte der letzten beiden Jahrzehnte ein komplexes Bild. Zahl, Intensität und Dauer der Konflikte haben zugenommen, und sie spiegeln tiefgreifende Veränderungen im Wesen des Krieges im 21. Jahrhundert wider.
Weitreichende Folgen
Die bewaffneten Konflikte der letzten beiden Jahrzehnte hatten weitreichende Folgen, die weit über die direkt betroffenen Länder und Regionen hinausgingen. Von humanitären Krisen bis hin zu globaler politischer Instabilität verändern ihre Auswirkungen die Welt auf komplexe Weise.
Etwa ein Viertel der Weltbevölkerung lebt heute in den betroffenen Gebieten und die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen dürfte im Jahr 2022 die 100-Millionen-Marke überschreiten – eine Rekordzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinter diesen Zahlen verbergen sich zahllose persönliche und familiäre Tragödien sowie bleibende körperliche und seelische Schäden.
Der Konflikt hatte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Die Infrastruktur, auch kritische Infrastrukturen, wird zerstört, die Ressourcen werden erschöpft und das Wirtschaftswachstum stagniert – eine weit verbreitete Realität in vielen Ländern. Laut Weltbank ist die Armutsrate in betroffenen Ländern um 20 Prozentpunkte höher als in Ländern ohne Konflikte. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Länder, sondern behindert auch die gemeinsamen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
Auf internationaler politischer Ebene haben Konflikte die Spaltungen zwischen den Großmächten vertieft und damit die Wirksamkeit multilateraler Mechanismen geschwächt. Das Risiko einer außer Kontrolle geratenen Verbreitung von Atomwaffen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist bei wichtigen Resolutionen immer wieder in eine Sackgasse geraten, wie etwa im Fall des Syrien-Konflikts oder in jüngster Zeit in der Ukraine. Dies führt dazu, dass das Ansehen internationaler Organisationen untergraben wird und auch die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, Konflikte zu verhindern und zu lösen, erheblich eingeschränkt wird.
Bewaffnete Konflikte schaffen außerdem ein günstiges Umfeld für die Entwicklung nicht-traditioneller Sicherheitsbedrohungen. Anhaltende Instabilität bietet transnationalen Terror- und kriminellen Organisationen einen fruchtbaren Boden für ihre Aktivitäten, wie dies beim IS im Irak und in Syrien der Fall ist. Darüber hinaus verschärfen Konflikte auch globale Probleme wie Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit und Krankheiten.
Der Trend zur Überverbriefung und zu steigenden weltweiten Militärausgaben führt dazu, dass erhebliche Mittel von den Entwicklungszielen abgezogen werden. Dies wirft große Fragen hinsichtlich der Fähigkeit der Menschheit auf, gemeinsame Herausforderungen wie Armut, Ungleichheit und Klimawandel zu bewältigen.
Die Auswirkungen der bewaffneten Konflikte der letzten beiden Jahrzehnte waren umfassend und weitreichend und gingen weit über den geografischen und zeitlichen Rahmen einzelner Konflikte hinaus. Von humanitären Krisen bis hin zu weltweiter politischer Instabilität, von Wirtschaftsabschwüngen bis hin zu neuen Sicherheitsherausforderungen – die Folgen von Konflikten stellen eine enorme Herausforderung für den Frieden, die Sicherheit und die nachhaltige Entwicklung der gesamten Menschheit dar.
Neue Probleme
Die Entwicklung bewaffneter Konflikte in den letzten beiden Jahrzehnten wirft mehrere wichtige Fragen auf.
Erstens erfordern die Komplexität und Vielfalt der Konfliktursachen einen proaktiveren, umfassenderen Ansatz, der die menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt der nationalen Sicherheit stellt. Zwar bestehen die traditionellen Bedrohungen weiterhin, doch Faktoren wie Ressourcenkonflikte, wirtschaftliche Ungleichheit und Klimawandel entwickeln sich zunehmend zu Quellen der Instabilität. Dies zwingt die Nationen dazu, das Konzept der nationalen Sicherheit über den rein militärischen Rahmen hinaus auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte auszuweiten.
Zweitens unterstreicht die Tendenz zu langwierigen und schwer lösbaren Konflikten die Bedeutung von Konfliktprävention und Vertrauensbildung. Statt sich ausschließlich auf die Stärkung militärischer Fähigkeiten zu konzentrieren, müssen die Länder mehr Wert auf präventive Diplomatie, die Förderung des Dialogs und den Aufbau wirksamer Mechanismen zur Krisenbewältigung auf regionaler und globaler Ebene legen.
Drittens führt die zunehmend wichtige Rolle der Technologie in modernen Konflikten zu einem dringenden Bedarf an verbesserten Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit und fortschrittlicher Militärtechnologie. Die Länder sollten Investitionen in Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen in Erwägung ziehen und gleichzeitig die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit stärken und die Entwicklung und Nutzung neuer Technologien im militärischen Bereich steuern.
Schließlich erfordert die abnehmende Wirksamkeit multilateraler Mechanismen bei der Konfliktlösung von der internationalen Gemeinschaft eine neue Herangehensweise an die globale Ordnungspolitik. Die Länder müssen sich zwar weiterhin dem Multilateralismus verpflichten, gleichzeitig aber die Reform bestehender internationaler Organisationen proaktiver vorantreiben und flexible Kooperationsmechanismen aufbauen, wobei der Schwerpunkt auf spezifischen Themen wie maritimer Sicherheit, grenzüberschreitendem Ressourcenmanagement oder der Reaktion auf den Klimawandel liegen muss.
Quelle: https://baoquocte.vn/nhung-gam-mau-xung-dot-vu-trang-trong-20-nam-qua-284304.html








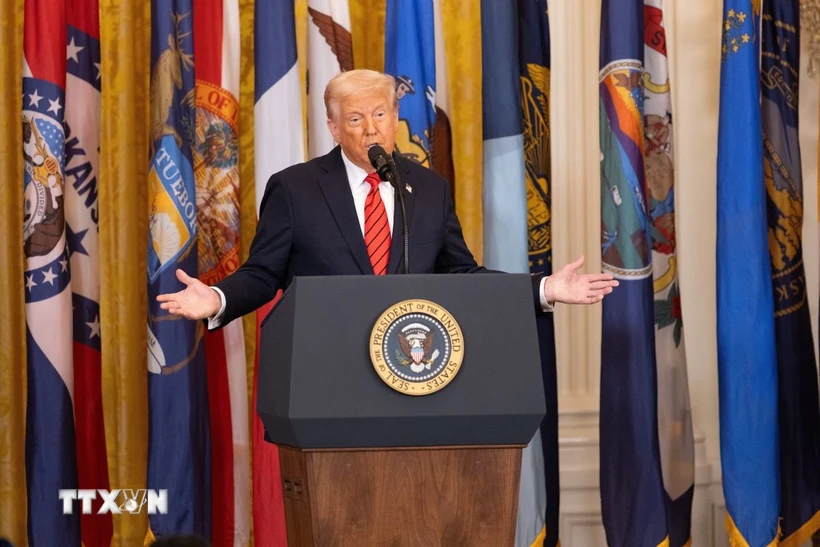






















![[Foto] „Schönheiten“ nehmen an der Paradeprobe am Flughafen Bien Hoa teil](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/11/155502af3384431e918de0e2e585d13a)






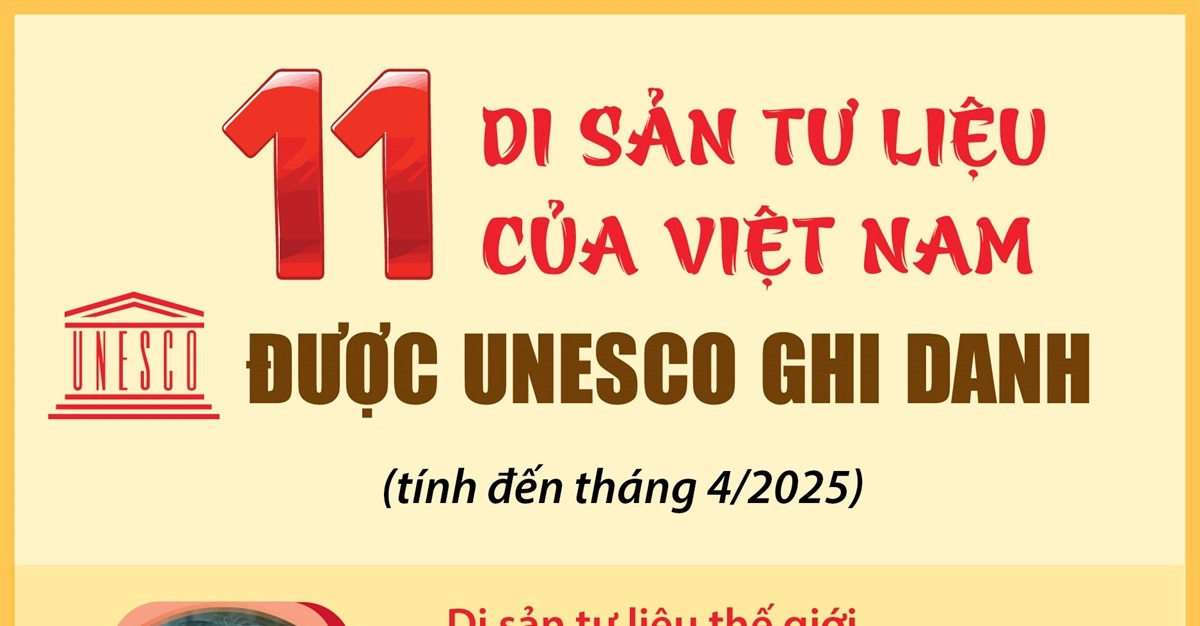
























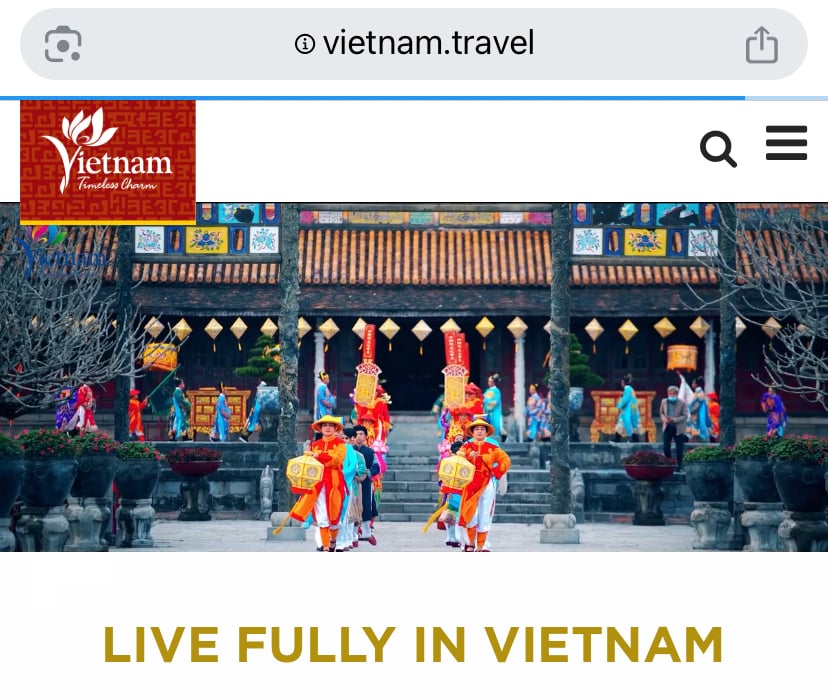
































Kommentar (0)