US- Forscher haben herausgefunden, dass Hybriden aus Tigerpythons und Indischen Pythons besser an ihren Lebensraum angepasst sind und sich daher weiter und schneller verbreiten können.

Eine Tigerpython hängt an einem Baumstamm im Everglades-Nationalpark. Foto: R. Cammauf
Die Hybridisierung zwischen Arten führt im Konflikt mit invasiven Pythons in Florida zu einem Dilemma. Vor einigen Jahren entdeckten Wissenschaftler, dass es sich bei einer großen Population von Riesenpythons, die in den Everglades umherstreiften, um Hybriden handelte, die durch die Paarung zweier verschiedener Arten entstanden waren: des Tigerpythons ( Python bivittatus ) und des Indischen Pythons ( P. molurus ). Bemerkenswerterweise scheinen sich die Hybridpythons besser an ihre neue Umgebung anzupassen als ihre Eltern, berichtete IFL Science am 21. Oktober.
Wie ihre Namen vermuten lassen, sind Tigerpythons und Indische Pythons in den tropischen Dschungeln Asiens heimisch und nicht in den Sümpfen Floridas. Forscher gehen davon aus, dass sie in den 1970er Jahren in den Staat eingeführt wurden, wahrscheinlich durch den Handel mit exotischen Haustieren. Die Population explodierte im August 1992, als der Hurrikan Andrew eine Python-Zuchtanlage in der Nähe der Everglades zerstörte und eine große Anzahl Pythons in die Wildnis entließ.
Die neue Sumpfumgebung ist für Pythons geeignet. Riesenpythons bildeten schnell Brutpopulationen und verdrängten einheimische Tiere durch ihren unersättlichen Appetit und ihre Jagdfähigkeiten. Seit die Pythonpopulation vor Jahrzehnten explosionsartig anstieg, sind kleine Säugetiere wie Sumpfkaninchen, Baumwollschwanzkaninchen und Füchse aus den Everglades fast vollständig verschwunden. Eine Studie aus dem Jahr 2012 ergab, dass die Waschbärpopulation in den Everglades allein seit 1997 um 99,3 Prozent zurückgegangen ist, die Opossumpopulation um 98,9 Prozent und die Rotluchspopulation um 87,5 Prozent.
Die Bemühungen zur Bekämpfung invasiver Pythons haben kaum Fortschritte gemacht, doch Wissenschaftler beobachten die Pythonpopulationen aufmerksam, um nach Lösungen zu suchen. Im Jahr 2018 führte ein Team des United States Geological Survey (USGS) eine genetische Analyse von etwa 400 Tigerpythons durch, die in einem großen Gebiet in Südflorida gefangen wurden. In der Fachzeitschrift „Ecology and Evolution“ veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, dass es sich bei mindestens 13 Pythons um genetische Hybride aus burmesischen und indischen Pythons handelte, was darauf schließen lässt, dass sie das Produkt einer interspezifischen Hybridisierung waren.
„Die Pythons in Südflorida sind körperlich als Tigerpythons erkennbar, genetisch ist die Sache jedoch komplizierter“, sagte Margaret Hunter, Genetikerin und Studienleiterin beim USGS.
Wenn sich zwei ähnliche Arten kreuzen, sind die Nachkommen normalerweise im Nachteil. Sie sind möglicherweise unfruchtbar oder stehen vor zahlreichen Herausforderungen, die sie für ihre Umgebung weniger geeignet machen. Manchmal kann jedoch die richtige Kombination einen Hybriden hervorbringen, der seinem nicht-hybriden Gegenstück überlegen ist. Dieser Zustand wird als Hybridkraft bezeichnet.
„Interspezifische Hybridisierung kann zu Hybridvitalität führen, was bedeutet, dass die besten Eigenschaften zweier Arten an ihre Nachkommen weitergegeben werden. Hybridvitalität kann zu einer besseren Anpassung an Umweltbelastungen und -veränderungen führen. Bei invasiven Populationen wie dem Tigerpython in Südflorida kann dies zu einer größeren Verbreitung oder schnelleren Ausbreitung führen“, erklärt Hunter.
Unterdessen geht der Kampf gegen invasive Pythons weiter. Einer der Gründe, warum Pythonpopulationen so schwer zu kontrollieren sind, liegt darin, dass sie sich in ihrer Umgebung äußerst gut tarnen können. Durch die Gentechnik könnten Wissenschaftler neue Waffen erhalten, um die Bedrohung besser zu verstehen. „Indem wir genetische Werkzeuge und Techniken verwenden und die Bewegungsmuster invasiver Pythons weiter verfolgen, können wir ihre bevorzugten Lebensräume und ihre Ressourcennutzung besser verstehen“, sagte die Co-Autorin der Studie, Kristen Hart, eine Ökologin beim USGS.
An Khang (Laut IFL Science )
[Anzeige_2]
Quellenlink


![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den französischen Botschafter in Vietnam, Olivier Brochet](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/49224f0f12e84b66a73b17eb251f7278)

![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, trifft sich mit herausragenden Arbeitern der Öl- und Gasindustrie](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/1d0de4026b75434ab34279624db7ee4a)
![[Foto] Abschluss des 4. Gipfels der Partnerschaft für grünes Wachstum und die globalen Ziele](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/c0a0df9852c84e58be0a8b939189c85a)
![[Foto] Die Zeitung Nhan Dan kündigt das Projekt „Love Vietnam so much“ an.](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/362f882012d3432783fc92fab1b3e980)
![[Foto] Förderung von Freundschaft, Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Armeen und Völkern beider Länder](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/0c4d087864f14092aed77252590b6bae)



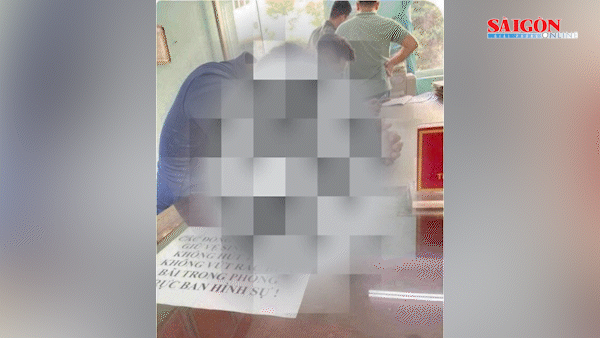




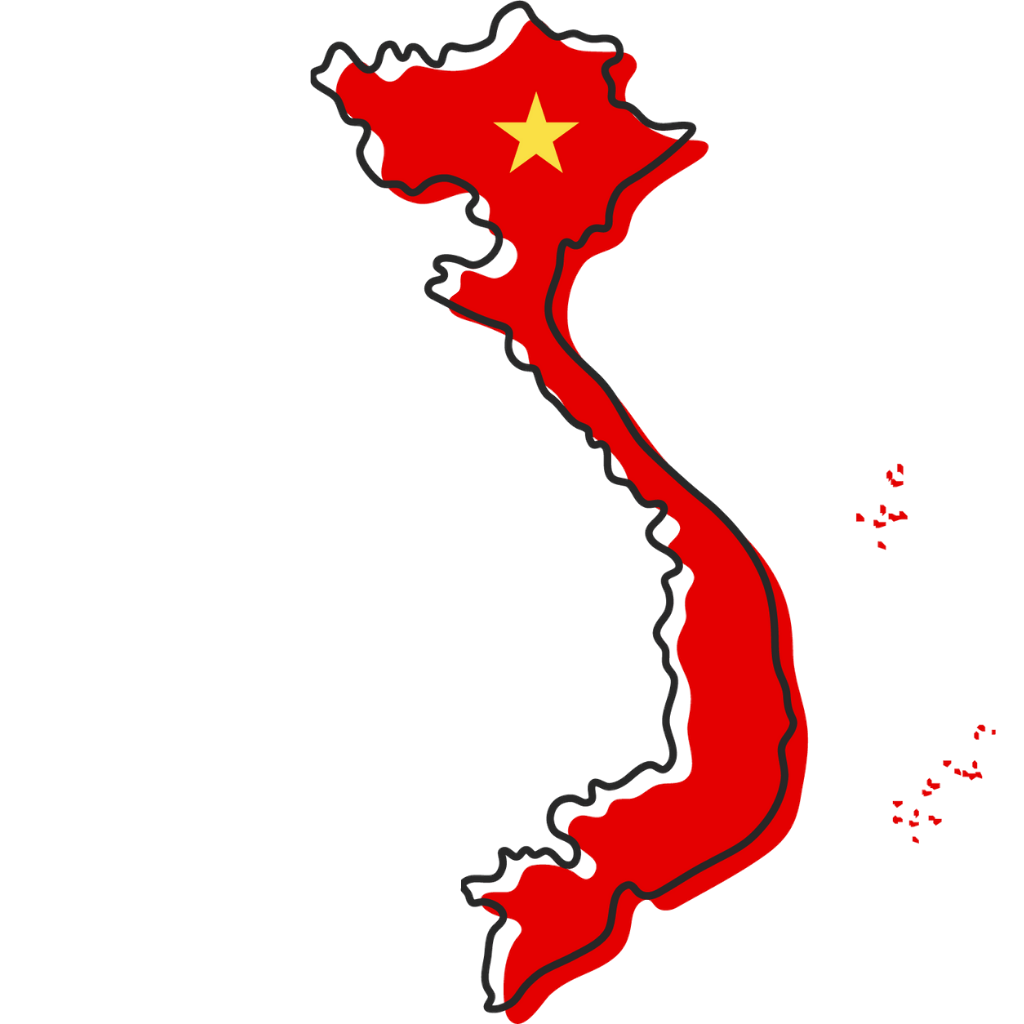















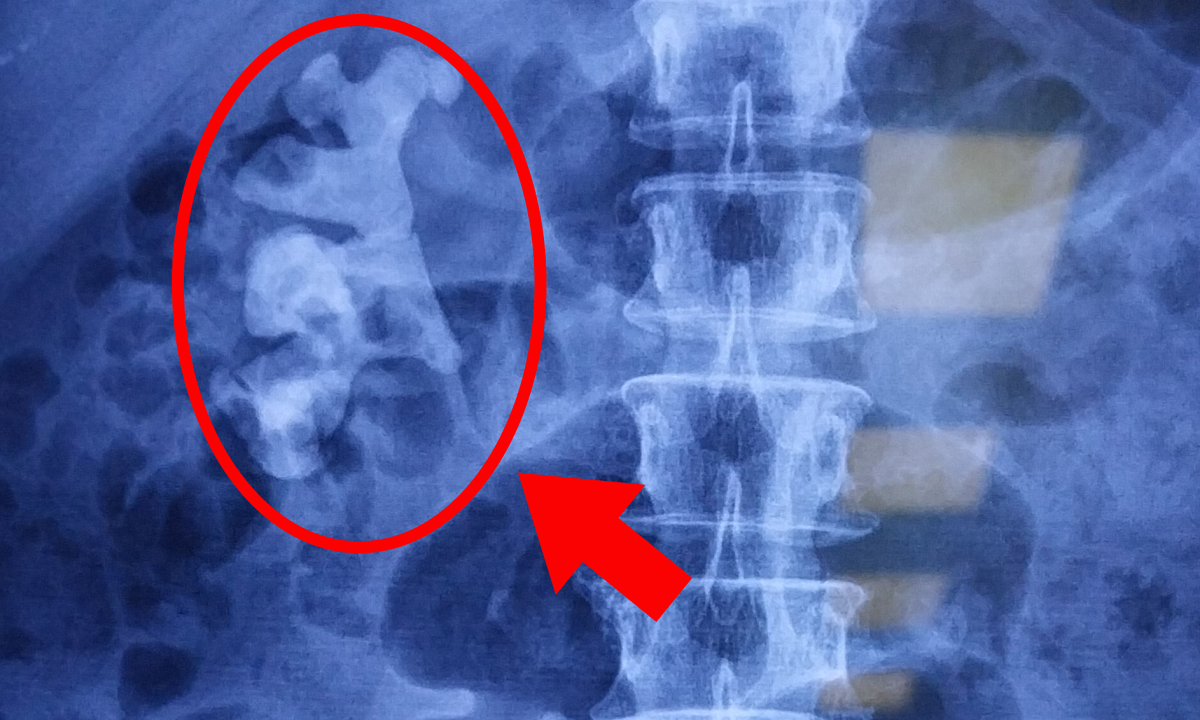

![[Foto] Begrüßungszeremonie für den chinesischen Verteidigungsminister und die Delegation zum Freundschaftsaustausch](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/fadd533046594e5cacbb28de4c4d5655)



























![[Video] Viettel nimmt offiziell die größte optische Unterseekabelleitung Vietnams in Betrieb](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/f19008c6010c4a538cc422cb791ca0a1)
























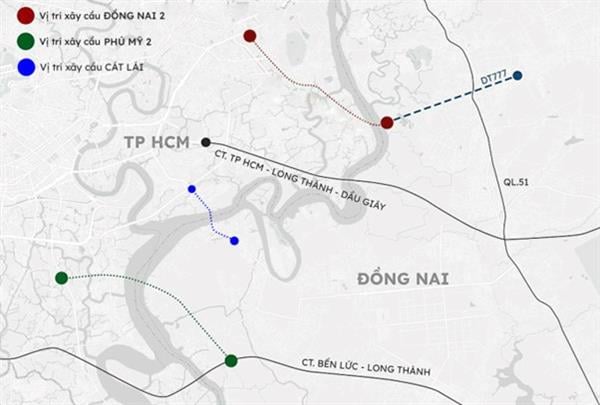















Kommentar (0)