Die Weltbank (WB) erklärte, die weltweiten Wachstumsaussichten seien besser. Allerdings stellen die Entstehung neuer Handelsschranken und eine weitverbreitete protektionistische Politik eine langfristige Bedrohung für das globale Wachstum dar. [Anzeige_1]
 |
| Die Weltbank erklärte, die weltweiten Wachstumsaussichten seien besser. |
In ihrem jüngsten Bericht „Global Economic Prospects“ erhöhte die Weltbank ihre Prognose für das globale Wachstum in diesem Jahr auf stabil 2,6 Prozent – gegenüber der Januar-Prognose von 2,4 Prozent – und prognostizierte für 2025 einen Anstieg auf 2,7 Prozent.
Fragiler Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2024?
„Vier Jahre nach den Schocks durch die Covid-19-Pandemie, die militärischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die Inflation und die Straffung der Geldpolitik scheint sich das globale Wirtschaftswachstum zu stabilisieren“, sagte Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank.
Allerdings leiden die ärmsten Volkswirtschaften der Welt weiterhin unter dem schleppenden Wachstum und kämpfen noch immer mit Inflation und hoher Schuldenlast. Die Weltbank stellte fest, dass die Volkswirtschaften, die mehr als 80 % der Weltbevölkerung ausmachen, in den nächsten drei Jahren ein langsameres Wachstum aufweisen werden als im Jahrzehnt vor der Pandemie. Unterdessen sind die besseren Prognosen auf die Widerstandsfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt – der USA – zurückzuführen. Doch die Industrieländer Europas und Japans verzeichnen ein jährliches Wachstum von lediglich 1,5 Prozent, und die Produktion bleibt niedrig. Im Gegensatz dazu verzeichnen Entwicklungs- und Schwellenländer, angeführt von China und Indonesien, ein Wachstum von 4 %.
Im Bericht zur Weltwirtschaftslage und den Aussichten kamen die Vereinten Nationen (UN) zu dem Schluss, dass sich die globalen Wirtschaftsaussichten im Vergleich zu früheren Prognosen verbessert hätten. Die großen Volkswirtschaften seien einer schweren Rezession entgangen, stünden aber noch immer vor einer Reihe von Herausforderungen. Den meisten großen Volkswirtschaften ist es gelungen, die Inflation zu senken, ohne dass es zu steigender Arbeitslosigkeit und damit zu einer Rezession kam.
Konkret prognostiziert der jüngste UN-Bericht für die Weltwirtschaft ein Wachstum von 2,7 % im Jahr 2024 und 2,8 % im Jahr 2025. Damit liegt er leicht über der Prognose vom Jahresbeginn, die für 2024 2,4 % und für 2025 2,7 % prognostiziert hatte. Die UN hat ihre Prognose zur Weltwirtschaft dank optimistischerer Konjunkturaussichten in den USA, die in diesem Jahr um 2,3 % wachsen könnten, und einigen führenden Schwellenländern wie Brasilien, Indien und Russland angehoben. Für Chinas Wirtschaft wird für das Jahr 2024 ein Wachstum von 4,8 Prozent prognostiziert, was einen leichten Anstieg gegenüber der im Januar prognostizierten Zahl von 4,7 Prozent darstellt.
Unterdessen erhöhte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr. Dies ist auf eine kräftige Erholung der US-Wirtschaft zurückzuführen, während die Eurozone hinterherhinkte. Demzufolge wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr die gleiche Wachstumsrate von 3,1 % wie im letzten Jahr beibehalten und im nächsten Jahr auf 3,2 % beschleunigen. In seinem Bericht vom Februar 2024 lagen die Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum für dieses und nächstes Jahr bei 2,9 % bzw. 3 %.
Trotz verbesserter Aussichten bleibt die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte jedoch weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und des „Brennpunkts“ zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen konfrontiert, die auf die gesamte Region übergreifen könnten. Auch die Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, nehmen zu und könnten den internationalen Handel instabiler machen. Die EU erwägt neue Steuern auf chinesische Ökoenergietechnologie, da die Besorgnis über die industriellen Überkapazitäten des Landes zunimmt …
Angesichts dieser fragilen Aussichten, so stellte die Weltbank fest, hätten „handelsverzerrende Maßnahmen“ wie Zölle und Subventionen seit der Covid-19-Pandemie stark zugenommen. Die Weltbank warnt, dass derartige Maßnahmen dazu neigen, die Lieferketten zu verzerren und sie dadurch weniger effizient zu machen. Zudem würden Handelsströme umgeleitet, um Einfuhrzölle zu vermeiden.
UN-Experten teilen diese Ansicht und sagen, dass die Konjunkturaussichten nur verhalten optimistisch seien, da anhaltend hohe Zinsen, uneinbringliche Kredite und eskalierende geopolitische Risiken weiterhin Hindernisse für ein stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum darstellten. Schwere Klimaschocks stellen eine erhebliche Herausforderung für die globale Wirtschaftsentwicklung dar und gefährden jahrzehntelange Entwicklungserfolge. Der rasante technologische Wandel – einschließlich künstlicher Intelligenz – bringt neue Chancen und Risiken für die Weltwirtschaft mit sich.
Gestaltung des multipolaren internationalen Wirtschaftsgleichgewichts
Die Website Eurasiareview kommentierte, dass die Weltpolitik ins Wanken gerate und ihr Schwerpunkt sich verschiebe. Westeuropa und Teile des Ostens geraten in Vergessenheit, der alte Kontinent Europa verliert allmählich an Reiz.
Anfang 2010 erklärte Prof. Gary Becker, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1992, in einem Kommentar im Telegraph, dass „Asien das neue Gravitationszentrum der Welt sein wird“. Es läge im Interesse Amerikas, die Tatsache zu akzeptieren, dass objektive demografische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen Asien im 21. Jahrhundert zum wichtigsten Gravitationszentrum der Welt machen.
Die Schwerpunktverlagerung von der Atlantikregion nach Ost- und Südasien ist eine unvermeidliche Entwicklung, die sich über Jahrzehnte angebahnt hat. Ein interessantes politisches Problem besteht darin, dass Moskau und Washington nur indirekt an diesem Prozess beteiligt sind. Von nun an wird der wachsende Einfluss der Länder dieser Region durch ihre politische Vorherrschaft weder geleugnet noch behindert.
In diesem Zusammenhang befinden sich die Beziehungen zwischen Russland und China derzeit auf ihrem Höhepunkt. Gemeinsam bilden die beiden wirtschaftlichen „Giganten“ ein solides Fundament für eine neue multipolare und ausgewogene internationale Ordnung. Laut GS. Gary Becker, die russisch-chinesische Zusammenarbeit hat sich seit fast 30 Jahren bewährt und in den letzten Jahrzehnten haben wir gemeinsam viele internationale Krisen überwunden. Der Westen müsse also eines verstehen: „Der Sand, den sie unter ihren Füßen bewegen spüren, ist viel tiefer und es handelt sich um unaufhaltsame Erdbeben.“
Dem Bericht „Asian Economic and Integration Outlook 2024“, der im März 2024 auf dem Boao-Forum veröffentlicht wurde, zufolge steht die asiatische Wirtschaft weiterhin vor zahlreichen internen und externen Herausforderungen, wird aber dank starker Konsumtreiber und einer proaktiven Finanzpolitik weiterhin eine relativ hohe Wachstumsrate aufrechterhalten.
Es wird erwartet, dass sich der Abwärtstrend im asiatischen Handels- und Tourismussektor umkehren wird. Die Haupttreiber hierfür sind das starke Wachstum des digitalen Handels, die schnelle Erholung des Tourismus sowie Fortschritte bei der Umsetzung von Wirtschafts- und Handelsabkommen wie der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Was die Attraktivität für Investitionen angeht, wird Asien als „immer noch voller Vitalität und als attraktives Investitionsziel“ eingestuft, wobei ausländische Direktinvestitionen vor allem in vier Hauptsektoren fließen: Konsum, Industrie, Elektronik und Halbleiter. Dies ist ein positives Signal, denn wenn mehr Investitionskapital in Sektoren wie die fortschrittliche Fertigung fließt, trägt dies zur Verbesserung der Produktivität und einer deutlichen Steigerung der Wertschöpfung asiatischer Produkte bei.
Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Reihe makroökonomischer Regulierungsmaßnahmen der großen Volkswirtschaften weiterhin Wirkung zeigen und dazu beitragen werden, die Erholungsdynamik der asiatischen Wirtschaft in diesem Jahr zu stärken.
In Asien befinden sich heute drei der fünf größten Volkswirtschaften der Welt. Allein China trägt mehr als 30 % zum globalen Wachstum bei. Die starke Entwicklung der letzten Jahre hat Asien zu einem unverzichtbaren Bindeglied in Bereichen wie Handel, Investitionen oder Produktion gemacht. Und die auffälligste Auswirkung ist der Trend zur Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts vom Westen in den Osten, wodurch ein multipolareres und ausgewogeneres internationales Wirtschaftsgleichgewicht entsteht.
Für die Länder der Region bietet die stabile Entwicklung der großen Volkswirtschaften zahlreiche Chancen zur Marktexpansion, zur Anziehung ausländischer Investitionen und zum Ausbau der Lieferketten. Darüber hinaus ist die führende Rolle dieser Volkswirtschaften auch eine wichtige Voraussetzung für die Förderung des Austauschs, der Zusammenarbeit und des regionalen Integrationsprozesses.
Natürlich bringt die rosige Zukunft auch viele Herausforderungen mit sich. Die kleineren Volkswirtschaften der Region müssen Anstrengungen unternehmen, um ihre Produktivität, Produktqualität sowie Infrastruktur und das Geschäftsumfeld zu verbessern und so ihre Wettbewerbsfähigkeit im Handel und bei Investitionen zu steigern.
Als Zentrum der globalen Lieferkette, das zahlreiche Arten von Gütern produziert und in die ganze Welt exportiert, behauptet die Wirtschaft des asiatischen Raums zunehmend ihre große Rolle in der Weltwirtschaft. Die wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den asiatischen Ländern wird der Region sicherlich dabei helfen, ihre Position in Zukunft weiter auszubauen.
[Anzeige_2]
Quelle: https://baoquocte.vn/kinh-te-toan-cau-trien-vong-dan-tuoi-sang-275701.html


![[Foto] Begrüßungszeremonie für den Premierminister der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien, Abiy Ahmed Ali, und seine Frau](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/77c08dcbe52c42e2ac01c322fe86e78b)
![[Foto] Die beiden Premierminister waren Zeugen der Unterzeichnungszeremonie der Kooperationsdokumente zwischen Vietnam und Äthiopien.](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/16e350289aec4a6ea74b93ee396ada21)
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh führt Gespräche mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed Ali](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/4f7ba52301694c32aac39eab11cf70a4)

![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, nimmt an der Zusammenfassung der Organisation der Konferenz des Exekutivkomitees der Frankophonen Parlamentarischen Union teil](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/fe022fef73d0431ab6cfc1570af598ac)
![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed Ali](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/086fa862ad6d4c8ca337d57208555715)








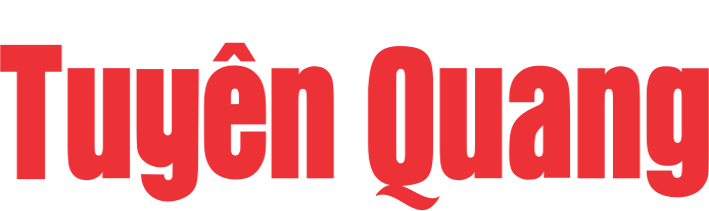










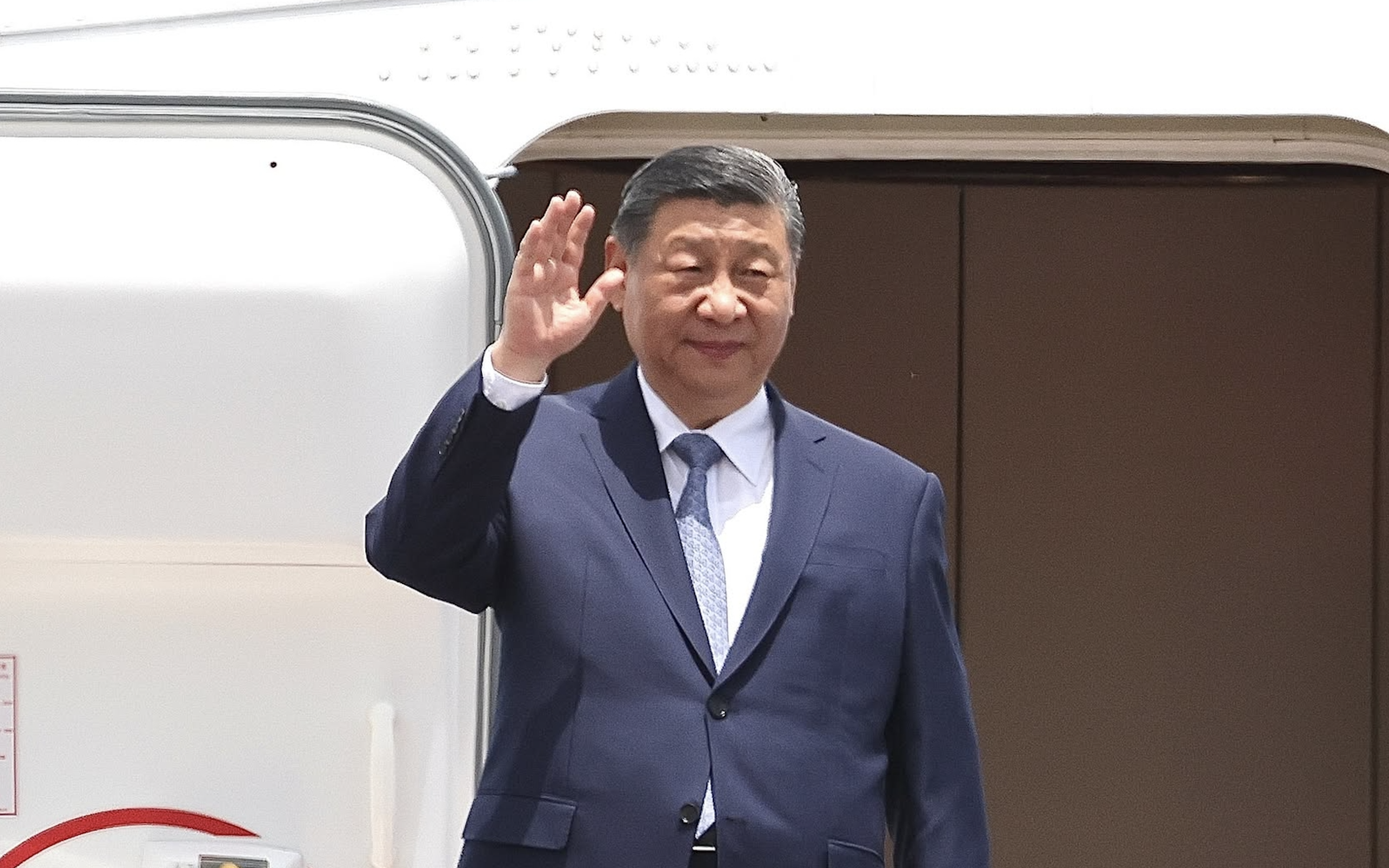

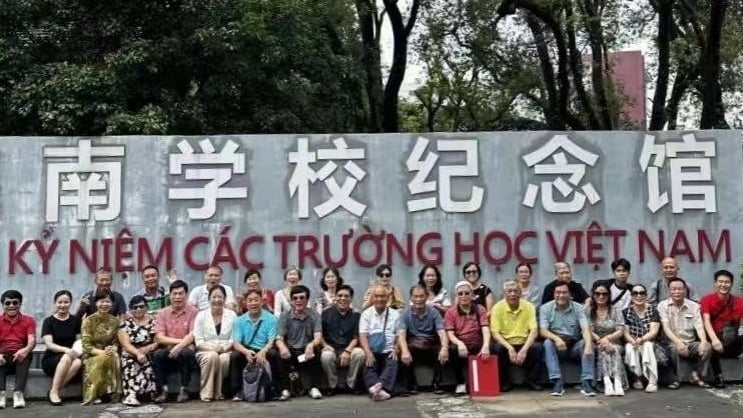





![[Foto] Generalsekretär To Lam trifft sich mit erfahrenen Revolutionskadern, verdienstvollen Persönlichkeiten und vorbildlichen Politikerfamilien](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/7363ba75eb3c4a9e8241b65163176f63)







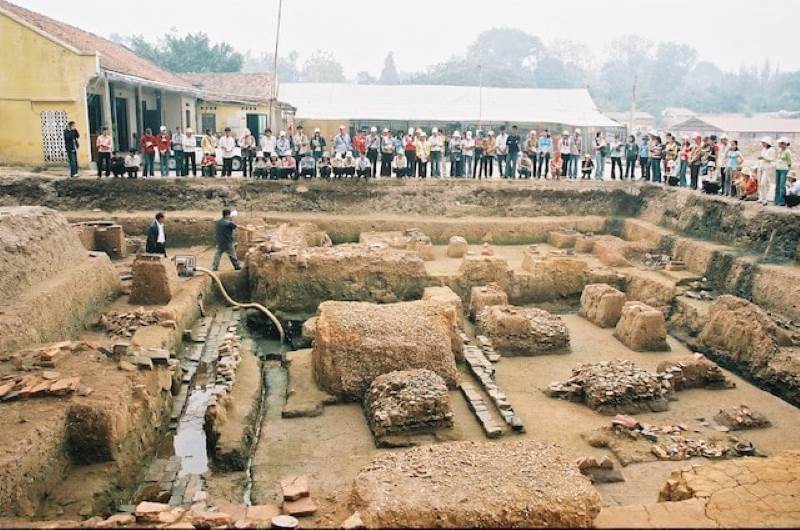







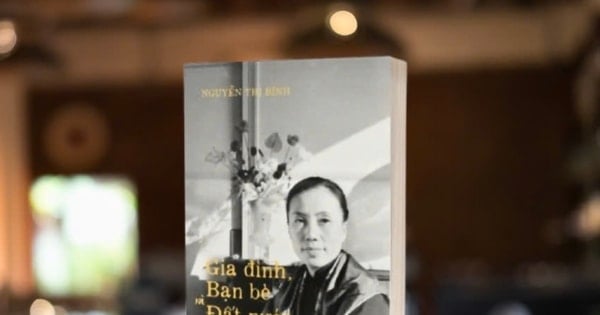

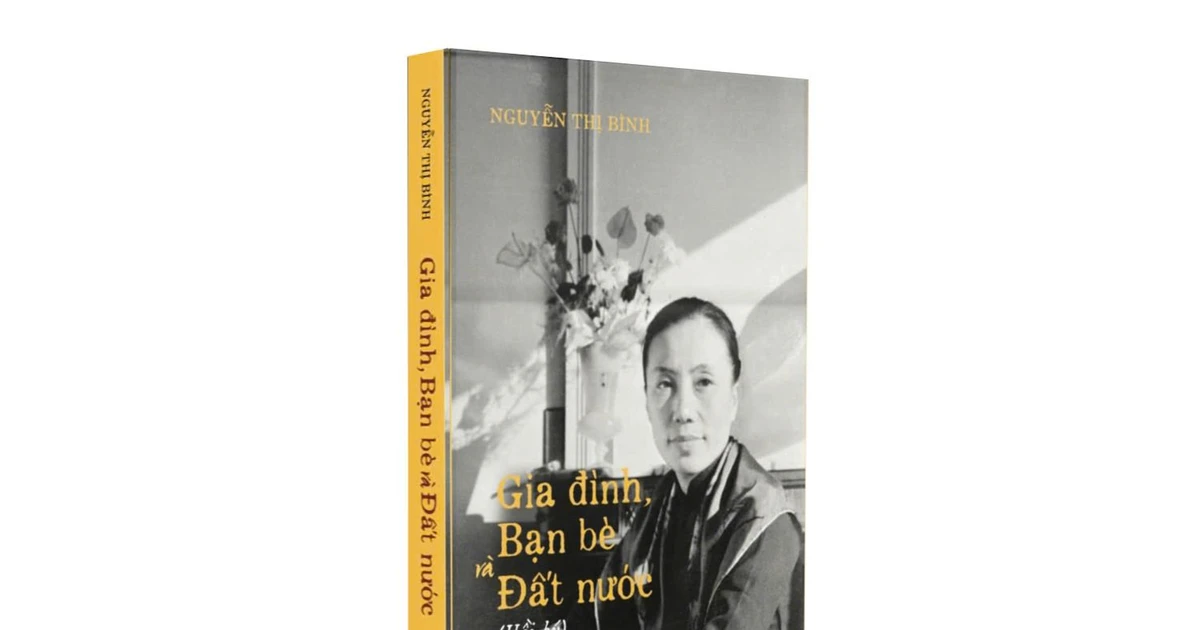
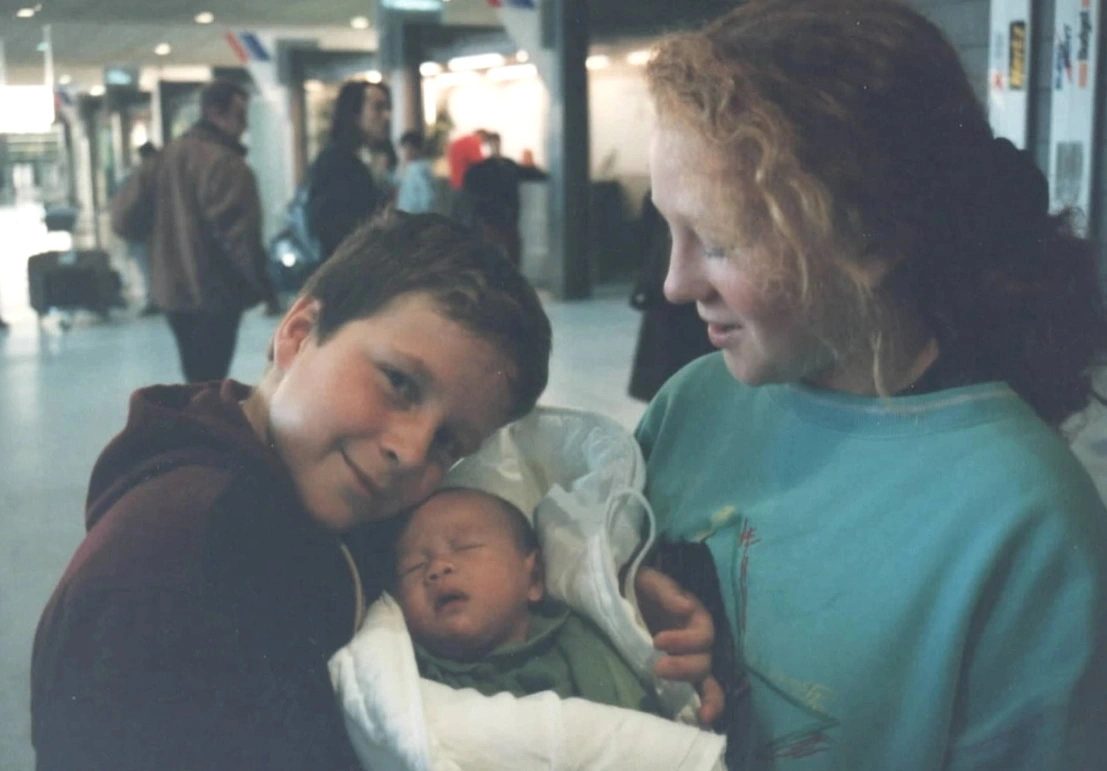





















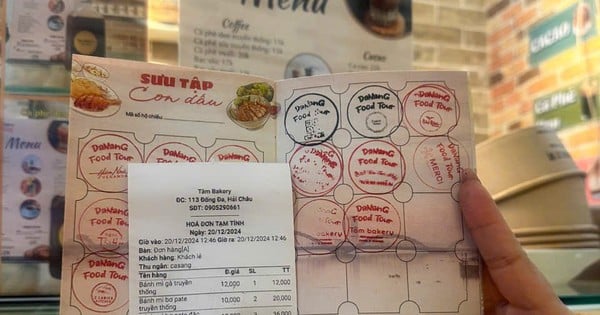






















Kommentar (0)