 |
| Das Risiko wird noch größer, da sich die deutsche Wirtschaft bereits in einer Rezession befindet. Je stärker sich die europäische Lokomotive von China abkoppelt, desto abhängiger wird sie. (Quelle: Shutterstock/esfera) |
Deutschland galt viele Jahre lang als die wirtschaftliche Lokomotive Europas und hat viele Krisen mit Bravour gemeistert. In Rezessionszeiten hat es sogar „das Team getragen“ und einige schwache Volkswirtschaften der Europäischen Union unterstützt.
Als Europas größte Volkswirtschaft und zugleich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt zwei Quartale in Folge (Q4/2022 und Q1/2023) offiziell in eine Rezession mit negativem Wachstum fiel, löste dies in der Geschäftswelt große Besorgnis aus.
Ein Umzug steht bevor?
Eine Studie des Bundesverbandes der Deutschen Wirtschaft (BDI) zeigt, dass immer mehr Unternehmen Arbeitsplätze und Produktion ins Ausland verlagern, während viele andere konkrete Maßnahmen erwägen, da die Sorgen um die deutsche Wirtschaft weiter wachsen.
Von den in der BDI-Studie erfassten Unternehmen haben 16 Prozent der mittelständischen Unternehmen Schritte zur Verlagerung von Betriebsteilen eingeleitet. Die Studie ergab außerdem, dass weitere 30 % erwägen, diesem Beispiel zu folgen.
BDI-Präsident Siegfried Russwurm sagte, fast zwei Drittel der befragten Unternehmen betrachteten die Energie- und Rohstoffpreise als eine ihrer dringendsten Herausforderungen. „Die Strompreise für Unternehmen müssen zuverlässig und nachhaltig auf ein wettbewerbsfähiges Niveau sinken, sonst wird die [grüne] Wende der Unternehmen scheitern“, sagte er.
Ähnliche Bedenken kamen auf, nachdem die USA den 500 Milliarden Dollar schweren Green Resilience Act (IRA) angekündigt hatten, der großzügige Subventionen für die grüne Industrie vorsieht. Als Reaktion auf die IRA und die steigenden Energiepreise hat der Elektroauto-Gigant Tesla einige seiner ehrgeizigen Pläne aufgegeben, darunter den Bau seiner größten Batteriefabrik in der Nähe von Berlin, und angekündigt, sich auf den US-Markt zu konzentrieren.
Auch in jüngster Zeit sind Bedenken hinsichtlich der deutschen Wirtschaft und ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit aufgekommen. So prognostizierte die Europäische Kommission im vergangenen Monat, dass das Land bis 2023 zu den am langsamsten wachsenden Volkswirtschaften der Eurozone gehören werde. Hohe Energiekosten und der CO2-Preis der EU werden wiederholt als Gründe für die Schwächung des Geschäftsklimas genannt.
Zusammenarbeit mit China intensivieren
Trotz der Forderungen nach einer Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen wächst die Abhängigkeit Deutschlands von der chinesischen Wirtschaft, insbesondere von Importen aus China, weiter.
Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass die Bundesregierung in den vergangenen Monaten zwar die deutschen Wirtschaftssektoren dazu aufgerufen hat, ihre Wirtschaftsbeziehungen aktiv zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von einem Land zu verringern. Doch die Untersuchungen des IW zeigen das Gegenteil.
Deutschland importiert zunehmend mehr Waren und Produkte aus China und wird dadurch immer abhängiger von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.
Im Jahr 2022 machten aus China importierte Komponenten und Rohstoffe innerhalb der in Deutschland produzierten Warengruppen mehr als die Hälfte des gesamten Importvolumens aus. Bis zu über 70 % aller deutschen Warengruppen importieren weiterhin vermehrt aus China.
So stammten im Jahr 2022 87 % aller Laptop-Importe nach Deutschland aus dem asiatischen Land (2021 waren es 84 %). Die Importe von Magnesiummetall, das in der Robotik und im 3D-Druck verwendet wird, aus China stiegen von 59 % im Jahr 2021 auf 81 % im Jahr 2022; Auch bei einigen Eisenprodukten stieg der Anteil von 74 % auf 85 %.
Das Problem, auf das der Autor dieser Studie, der Experte Jürgen Matthes, hinweist, besteht darin, dass nicht alle Produkte, bei denen China einen großen Marktanteil hat, unverzichtbar und schwer zu ersetzen sind, beispielsweise Heizdecken und Heizmatratzen (Chinas Marktanteil beträgt 84 %). Tatsächlich können diese Produkte innerhalb kurzer Zeit auf andere Anbieter umgestellt werden.
Natürlich ist Deutschland bei vielen anderen Produktarten, etwa bei bestimmten chemischen Materialien und elektronischen Bauteilen, tatsächlich auf Lieferungen aus China angewiesen. Typische Beispiele sind Magnesium und einige seltene Erden.
Auf diese große Abhängigkeit hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wiederholt hingewiesen. Einer aktuellen Analyse des BDI zufolge machen die Importe einiger Rohstoffe aus China, beispielsweise seltener Erden, die zur Herstellung von Elektrobatterien verwendet werden, mehr als 90 Prozent der gesamten deutschen Importe dieser Materialien aus.
Obwohl sie nicht so selten sind, wie ihr Name vermuten lässt, ist ihr Abbau teuer und sehr umweltschädlich. Daher ist es kurzfristig sehr schwierig, Lieferungen aus China durch Lieferungen aus anderen Ländern zu ersetzen. Viele andere wichtige Rohstoffe befinden sich in einer ähnlichen Situation.
Experte Matthes merkte an, dass eine Diversifizierung der Bezugsquellen und eine Beseitigung der Abhängigkeit von China kaum im großen Stil vorkomme.
Benachteiligung gehört zu Berlin?
Im Gegenteil, bei vielen Arten von Produkten und Gütern wächst die Abhängigkeit von Peking. Je stärker China bei einem Produkttyp die Welt dominiert, desto schwieriger ist es, alternative Lieferanten zu finden.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine aktuelle Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Dementsprechend birgt die globale Dominanz Chinas und Taiwans (China), insbesondere bei elektronischen Produkten, in Verbindung mit der Abhängigkeit Deutschlands von diesen Produkten große Risiken für Europas führende Volkswirtschaft.
Im Handel allgemein ist die Situation ähnlich, wobei sich die Beziehungen zunehmend zu Ungunsten Deutschlands verschieben. Im Jahr 2022 war China das siebte Jahr in Folge Deutschlands größter Handelspartner.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beträgt der Anteil der Waren, die Deutschland aus China importiert, 12,8 Prozent der gesamten deutschen Warenimporte. Diese Zahl ist bemerkenswert und zeigt die große Abhängigkeit der führenden Volkswirtschaft Europas von Warenlieferungen aus China.
In den letzten Jahren ist die Menge der aus China importierten deutschen Waren tendenziell von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Exportsektor ist jedoch das Gegenteil der Fall: Die Menge deutscher Warenexporte nach China ist rückläufig.
Im Jahr 2022 belegte China in der Liste der größten Absatzmärkte Deutschlands lediglich den vierten Platz. Die ersten drei Plätze belegen die USA, Frankreich und die Niederlande. Experten aus der Forschung warnen, dass die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen zunehmend ungleicher würden, was Berlin zum Nachteil gereichen würde. Betrug das deutsche Handelsdefizit gegenüber China im Jahr 2010 noch 23,5 Milliarden Euro (25,7 Milliarden US-Dollar), so lag dieser Wert im Jahr 2022 bereits bei 84,1 Milliarden Euro.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die deutsche Wirtschaft zudem stark von Investitionen aus China abhängig. Deutsche Unternehmen investieren seit vielen Jahren große Summen Kapital in diesen Markt. Deutsche Investoren gehörten in den letzten Jahren stets zu den fünf größten europäischen Investoren in China.
Mehrere deutsche Unternehmen betreiben seit vielen Jahren einen Großteil ihrer Produktions- und Geschäftstätigkeit in dem asiatischen Land. So macht beispielsweise der Umsatz des Halbleiterunternehmens Infineon auf dem chinesischen Markt mehr als ein Drittel seines Gesamtumsatzes aus. Auch deutsche Autohersteller wie VW, Mercedes und BMW sind stark auf den Absatz auf dem chinesischen Markt angewiesen.
Deutsche Unternehmen sind zunehmend daran interessiert, in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu investieren. Eine Analyse des IW hat ergeben, dass deutsche Unternehmen trotz geopolitischer Spannungen im Jahr 2022 mit insgesamt 11,5 Milliarden Euro so viel direkt in China investierten wie nie zuvor.
Tatsächlich sind für Deutschland die Länder der Europäischen Union (EU) und die USA trotz der großen Abhängigkeit von China nach wie vor die wichtigsten Handelspartner, auch wenn Peking der größte Handelspartner ist.
Einer gemeinsamen Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Bertelsmann Stiftung, des Merics Institute for China Studies und des IW zufolge liegen die EU-Länder bei der Zahl der Beschäftigten, dem Umsatz und dem Anteil deutscher Tochtergesellschaften an der Spitze. Den zweiten Platz belegen die USA, während China auf dem dritten Platz liegt.
Die Studie ergab, dass mehr als 40.000 deutsche Unternehmen im Ausland tätig sind, fast 8 Millionen Menschen beschäftigen und einen Jahresumsatz von fast 3,1 Billionen Euro erwirtschaften. Der Anteil der in China tätigen Unternehmen sei davon nur „relativ moderat“. Ziel der meisten Direktinvestitionen deutscher Unternehmen ist nicht etwa die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern vor allem die EU-Länder und die USA.
Die Studie ergab außerdem, dass der Anteil deutscher Direktinvestitionen in China, der aus den Gewinnen deutscher Unternehmen in China stammt, steigt. Von 2018 bis 2021 stammten alle deutschen Direktinvestitionen in China aus diesen Gewinnen.
Experten gehen davon aus, dass die Wirtschaft beider Länder in Zukunft noch enger miteinander verknüpft sein wird, da der Wunsch nach einer Fortsetzung der Zusammenarbeit – wie es das Ziel der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen war – bestätigt wurde.
[Anzeige_2]
Quelle




![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den Ersten Stellvertretenden Generalsekretär des African National Congress (ANC) von Südafrika](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/bb2999907e1245d5b4c7310a890d8201)

























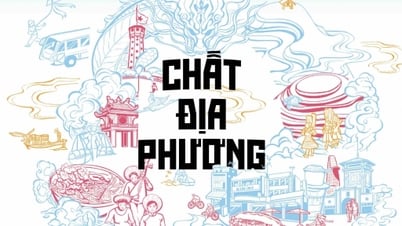



![[Foto] Vietnamesischer Schiffsbau mit dem Anspruch, den Ozean zu erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/24ecf0ba837b4c2a8b73853b45e40aa7)
![[Foto] Preisverleihung für Arbeiten zum Studium und zur Nachfolge von Präsident Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/a08ce9374fa544c292cca22d4424e6c0)


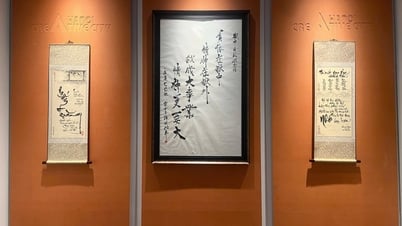
































































Kommentar (0)