 |
| Steckt hinter Ungarns zögerlichem Einverständnis ein „unterirdischer Sturm“ innerhalb der EU? Auf dem Foto: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. (Quelle: WSJ) |
„Eine weitere Fehlentscheidung der EU“
Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hat gerade erklärt, dass Budapest kein Veto gegen das 13. Sanktionspaket der EU gegen Russland einlegen werde. „Es gibt keinen Grund für ein Veto. Allerdings glaube ich, dass die EU weiterhin die falschen Entscheidungen trifft“, sagte Szijjarto.
Herr Peter Szijjarto bekräftigte außerdem, dass die Verhängung weiterer Sanktionen der EU gegen Russland sinnlos sei und der Wirtschaft des Blocks lediglich schaden werde.
Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass Ungarn bei einem Treffen der EU-Botschafter am 14. Februar weiterhin das einzige Land war, das ein neues Sanktionspaket gegen fast 200 Einzelpersonen und Organisationen aus Russland, China und anderen Ländern, die Moskau im militärischen Konflikt mit der Ukraine unterstützen sollen, nicht unterstützte. Laut der Nachrichtenagentur hat Ungarn das neue Sanktionspaket aufgrund der Präsenz chinesischer Unternehmen auf der Liste blockiert.
Bei einer offiziellen Sitzung des EU-Außenministerrats am 19. Februar, die von Brüssel organisiert wurde, legte Ungarn jedoch kein Veto gegen das neue Sanktionspaket ein – das 13. Sanktionspaket, das die EU gegen Russland verhängt hat.
Auf seiner persönlichen Facebook -Seite schrieb der ungarische Außenminister, dass die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten das 13. Sanktionspaket gegen Russland erörterten, das voraussichtlich am 24. Februar in Kraft treten wird – dem zweiten Jahrestag der speziellen Militäroperation Moskaus in der Ukraine.
Mit dem neuen Sanktionspaket hat die EU 193 natürliche und juristische Personen ins Visier genommen. Die meisten von ihnen sind Russen, aber die Beschränkungen nehmen zu und betreffen möglicherweise auch Einzelpersonen und Unternehmen aus Weißrussland, China, Indien, der Türkei und Nordkorea.
Bemerkenswert ist, dass erstmals seit der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts asiatische Unternehmen, darunter drei chinesische und ein indisches Unternehmen, auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Brüssel wirft den vier asiatischen Unternehmen vor, Moskau dabei geholfen zu haben, die EU-Beschränkungen zu umgehen, und zwar vor allem durch die Lieferung von Teilen, die für den Einsatz in Drohnen und anderen Waffensystemen umfunktioniert werden können.
Mit Ungarns Zustimmung haben sich die Mitgliedstaaten inzwischen endlich auf das 13. EU-Sanktionspaket gegen Russland geeinigt, das voraussichtlich Ende Februar vom Europäischen Parlament gebilligt wird.
Ungarn vertritt seit der Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 eine neutrale Haltung. Budapest verurteilte die militärischen Aktionen Moskaus, versuchte, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu begrenzen und forderte eine diplomatische Lösung der Krise. Ungarische Politiker haben wiederholt erklärt, dass die Sanktionen der EU mehr schaden als Russland.
Wird die ungarische Wirtschaft getroffen?
Wie schon bei früheren EU-Sanktionspaketen gegen Russland hatten Beobachter vorausgesagt, dass Ungarn – ein EU-Mitgliedstaat, der zwar als prorussisch gilt, aber stets die Beschränkungen für Russland und die Militärhilfe für die Ukraine kritisiert hat – auch weiterhin gegen das Sanktionspaket stimmen würde. Doch dazu kam es nicht. Was steckt hinter der plötzlichen Entscheidung Budapests?
Beobachter meinen, dass Brüssels Verhandlungsinstrument erneut Wirkung zeigen könnte, da es der EU bereits beim EU-Gipfel (1. Februar) zum Erfolg verholfen hatte: Ein zusätzliches Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine wurde beschlossen, und damit endete die wochenlange Blockade aufgrund des Widerstands des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.
Als EU-Mitglied war die Beziehung zwischen Ungarn und der EU in den letzten zehn Jahren nicht so eng. Unter dem Druck der EU-Staats- und Regierungschefs verzichtete Orban am 1. Februar bei seinem Gipfeltreffen auf Gespräche mit der Presse. Stattdessen postete er am selben Tag im sozialen Netzwerk X ein Bild von sich, wie er vor einer Bauerndemonstration in Brüssel (Belgien) um Traktoren herumgeht.
Zuvor hatte die FT am 29. Januar einen Artikel veröffentlicht, in dem es hieß, Brüssel könne sein „Verhandlungsinstrument“ einsetzen und mit einem „Angriff“ auf die ungarische Wirtschaft drohen, sollte Ministerpräsident Orban ein Veto gegen neue Hilfen für die Ukraine einlegen. Die Strategie der EU besteht darin, Investoren von der ungarischen Wirtschaft abzuschrecken. Dazu streicht sie die Finanzierung für Budapest und setzt als Gegenleistung die Zustimmung des Landes zu einem 50 Milliarden Euro schweren Hilfspaket für die Ukraine aus dem EU-Haushalt voraus.
Der Plan Brüssels markiere eine erhebliche Eskalation innerhalb der EU, insbesondere mit ihrem prorussischsten Mitgliedsstaat, hieß es in dem FT- Artikel.
In einem von EU-Beamten verfassten Dokument skizzierte Brüssel einen „geheimen Plan“, der explizit auf die wirtschaftlichen Schwächen Ungarns abzielte, die seine Währung gefährdeten und das Vertrauen der Investoren schwächen würden. Mit diesem Plan sollten „Arbeitsplätze und Wachstum“ geschädigt werden, falls Budapest sein Veto gegen den Hilfsplan für Kiew nicht aufheben würde.
Ministerpräsident Viktor Orban blockiert seit langem hartnäckig die Verwendung des gemeinsamen Haushalts der EU für die Bereitstellung von 50 Milliarden Euro (54 Milliarden Dollar) an Hilfsgeldern für die Ukraine. Als Grund nennt er fehlende Mechanismen zur Kontrolle der Verwendung des Geldes durch Kiew. Orban sagte außerdem, die EU-Länder sollten Kiew mit eigenen Mitteln unterstützen, statt auf den gemeinsamen Fonds des Blocks zurückzugreifen.
Im Gegensatz dazu hieß es aus Brüssel, falls Ungarn nicht nachgeben würde, sollten andere EU-Staats- und Regierungschefs öffentlich eine dauerhafte Kürzung aller EU-Mittel für Budapest ankündigen. Ziel sei es, die Märkte zu destabilisieren, den Wert des Forint zu senken und die Kreditkosten der Wirtschaft zu erhöhen.
Das EU-Dokument macht deutlich, dass ohne EU-Finanzierung „das Interesse der Finanzmärkte sowie europäischer und internationaler Unternehmen an Investitionen in Ungarn abnehmen könnte“. Eine solche Strafe könne „schnell zu einer weiteren Kostensteigerung bei der Finanzierung des öffentlichen Defizits und zu einem Wertverlust der Währung führen“.
Vor dem 1. Februar erklärte Ungarns EU-Minister János Bóka: „Ungarn stellt keine Verbindung zwischen seiner Unterstützung für die Ukraine und der Möglichkeit seiner Wirtschaft her, auf EU-Gelder zuzugreifen, und verweigert anderen diesen Schritt.“ Budapest hat sich in den Verhandlungen mit der EU konstruktiv engagiert und wird dies auch weiterhin tun, ohne dem Druck nachzugeben.
Tatsächlich jedoch hat der zunehmende Druck der EU Budapest zu einem Kompromiss gezwungen. Und je mehr Warnungen hinzukommen, desto größer wird die Chance, die ungarische Regierung zu einem Sinneswandel zu zwingen.
Das von einem Beamten der Europäischen Kommission herausgegebene Dokument skizziert die wirtschaftlichen Schwächen Ungarns – darunter „sehr hohe öffentliche Defizite“, „sehr hohe Inflation“, eine schwache Währung und die höchste Schuldenquote in der EU.
Aus dem Dokument geht auch hervor, dass „Beschäftigung und Wachstum der ungarischen Wirtschaft in hohem Maße von ausländischer Finanzierung abhängig sind, die auf hohen EU-Mitteln basiert“.
Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man würde durchgesickerte Informationen nicht kommentieren.
Allerdings hat das "Verhandlungsinstrument" nie Brüssel muss enttäuscht sein. Nicht nur dieses Mal hat die EU ihren finanziellen Einfluss auch schon früher genutzt, um mit den Mitgliedsstaaten zu „sprechen“, etwa mit Polen und Ungarn wegen Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit oder mit Griechenland während der Eurokrise.
„Aber eine explizite Strategie zur Untergrabung der Wirtschaft eines Mitgliedsstaates würde eine neue Eskalation der internen Beziehungen des Blocks bedeuten“, so die FT .
[Anzeige_2]
Quelle


![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Konferenz zur Bekämpfung von Schmuggel, Handelsbetrug und gefälschten Waren](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/14/6cd67667e99e4248b7d4f587fd21e37c)












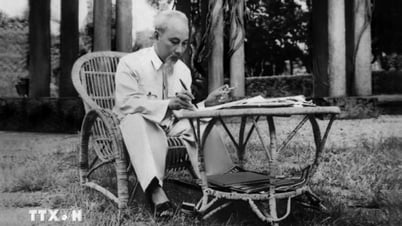



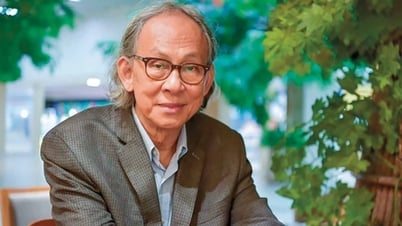

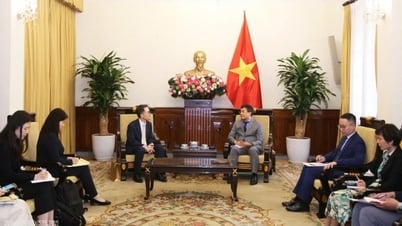














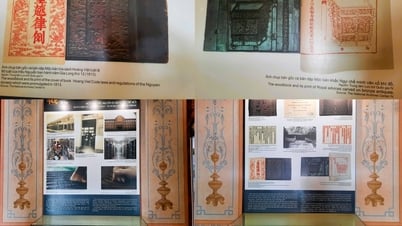








































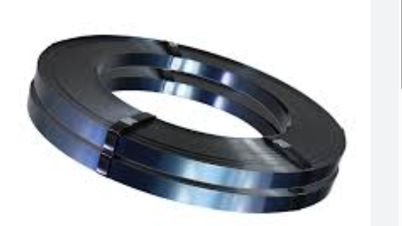

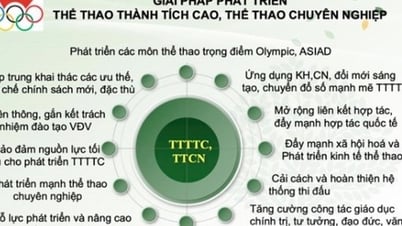





















Kommentar (0)