 |
| Das Kernkraftwerk Isar 2 in Deutschland wird am 15. April 2023 abgeschaltet. (Quelle: MAGO) |
Im April 2023 nahm Berlin seine letzten drei Atomkraftwerke vom Netz und die Technologie gehört damit der „Geschichte“ an. Die drei geschlossenen Werke waren Isar II, Emsland und Neckarwestheim II.
Einst galt die Kernspaltung als die Zukunft. Anfang der 1960er Jahre glaubten Politiker und Wissenschaftler in Deutschland, dass die Energiegewinnung eine unerschöpfliche Quelle für Elektrizität ohne Luftverschmutzung sein würde. Damals wurde über die Gefahr eines Atomunfalls kaum diskutiert.
Der Greenpeace-Atomenergieexperte Heinz Smital sagt, die Politiker seien damals begeistert gewesen: „Die Atomenergie profitierte davon, dass sich Länder wegen der Atomwaffen für diese Technologie interessierten. Energiekonzerne hingegen nicht.“
„In den 1960er Jahren war Deutschland noch im Wirtschaftswundermodus. Es herrschte eine große, fast naive Technikgläubigkeit“, ergänzte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium.
Damals war die Luft in weiten Teilen Deutschlands sehr schmutzig und der Himmel oft bewölkt, insbesondere über dem stark industrialisierten westlichen Ruhrgebiet, wo ein Großteil der Stahl- und Kohleindustrie konzentriert war. Kohlekraftwerke sind eine wichtige Stromquelle. Damals erschien die Kernenergie als naheliegende Alternative und versprach eine „saubere“ Energiequelle.
Ähnliches galt auch in der ehemaligen DDR, wo 1961 das erste kommerzielle Kernkraftwerk in Betrieb ging. In den folgenden Jahren gingen insgesamt 37 Atomreaktoren ans Netz.
Vorfälle von Three Mile Island und Tschernobyl
In den 1970er Jahren änderte sich die Einstellung. Aktivisten der damals wachsenden Umweltbewegung protestierten auf Baustellen für neue Atomkraftwerke.
Im Jahr 1979 ereignete sich im US-amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island der bis dahin weltweit schwerste Unfall. „Der Atom-Hype weicht zunehmend der Erkenntnis, dass Atomenergie nicht beherrschbar ist“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen.
Sieben Jahre nach dem Atomkraftwerksunglück in den USA kam es in der Ukraine, damals Teil der Sowjetunion, zur Katastrophe von Tschernobyl. Am 26. April 1986 verursachte eine Reaktorexplosion den hinsichtlich Kosten und Opfern schlimmsten Atomunfall der Geschichte. Die Verschmutzung des Gebiets ist bis heute andauernd und die Folgen sind noch nicht behoben.
Die Katastrophe von Tschernobyl trug dazu bei, dass in Deutschland die Skepsis gegenüber der Atomkraft wuchs. „Der Bau der Kraftwerke ist danach ins Stocken geraten“, sagt Heinz Smital von Greenpeace. Allein in Deutschland ist der Bau von 60 Atomkraftwerken geplant.“
1980 ging aus der Anti-Atomkraft-Bewegung die Partei Die Grünen hervor. Ein zentraler Bestandteil des Programms des Landes ist die Abschaltung von Atomreaktoren.
1983 zog die Partei in den Deutschen Bundestag ein. 1998 wurden die Grünen erstmals Teil einer Regierungskoalition und schlossen sich der Sozialdemokratischen Partei (SPD) an. Beide Seiten haben sich für einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie eingesetzt, stoßen dabei aber auf heftigen Widerstand der Mitte-Rechts-Parteien der Christdemokraten (CDU) und der Christlich-Sozialen Union (CSU), die einen „schrittweisen Ausstieg“ fordert.
Doch 2011 änderten CDU und CSU nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima ihre Haltung. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland.
Im April 2023 soll der letzte Reaktor des westeuropäischen Landes vom Netz gehen.
Forderung nach mehr Fabriken
Seitdem haben CDU und CSU ihre Haltung zur Atomenergie geändert. Viele in der Partei fordern inzwischen den Bau neuer Reaktoren.
CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete die Schließung der letzten Meiler als „einen schwarzen Tag für Deutschland“.
Die Parteien argumentierten zudem, dass alte Reaktoren wieder ans Netz angeschlossen werden müssten. Das Land solle angesichts der steigenden Öl- und Gaspreise seine letzten drei stillgelegten Kraftwerke wieder in Betrieb nehmen, sagte Merz.
Bei den Energieunternehmen in Europas führender Volkswirtschaft stoßen diese Vorschläge allerdings auf wenig Zustimmung.
Umweltministerin Steffi Lemke zeigte sich wenig überrascht: "Die Energiekonzerne haben sich längst darauf eingestellt und lehnen die Atomenergie in Deutschland noch heute ab. Atomenergie ist eine Hochrisikotechnologie, der radioaktive Müll bleibt noch Jahrtausende giftig und wird viele Generationen beschäftigen."
 |
| Ein Stoppschild vor dem Kernkraftwerk Emsland im westdeutschen Lingen. (Quelle: AFP) |
Kernenergie weltweit
Derzeit sind weltweit 412 Reaktoren in 32 Ländern im Einsatz. Im Laufe der Jahre wurden einige neue Reaktoren gebaut, andere wurden stillgelegt, sodass die Zahl im Wesentlichen unverändert blieb.
Länder wie China, Frankreich und Großbritannien haben neue Bauprojekte angekündigt. Einige Länder beabsichtigen inzwischen, kleine, moderne Reaktoren zu bauen.
Laut Greenpeace-Experte Smital dienen kleine Reaktoren häufig eher militärischen Zwecken als der Energieerzeugung.
"Einer davon steht in Nordkorea. Dort wird Brennstoff für das gesamte Atomwaffenprogramm des Landes produziert. Das Problem ist nicht die Wirtschaftlichkeit. Ich sehe in diesen kleinen Reaktoren eine große Gefahr", sagte er.
Problem der Abfalllagerung
In Deutschland ist die Frage nach der Lagerung gefährlicher Atomabfälle weiterhin ungeklärt. Dieses Material wurde lange Zeit in provisorischen Lagern in der Nähe von Kernkraftwerken gelagert. Dies ist jedoch keine langfristige Lösung.
Die Behörden müssen geeignete Standorte suchen, auswählen und Probebohrungen durchführen. Lokale Gemeinden, die nicht wollen, dass Atommüll in ihrer Nähe vergraben wird, erheben häufig Einwände. Es ist schwierig, die dafür nötigen Mittel und den richtigen Zeitpunkt zu finden.
„Dazu kann ich im Moment noch keine Einschätzung abgeben“, sagt Dagmar Dehmer von der Atommüllentsorgungsbehörde des Bundes. Wir müssen uns mehrere Bereiche ansehen. Die Bohrungen zur Suche nach Atommüll-Lagerstätten kosten Millionen Euro. Allein die Begutachtung kostete rund 5 Millionen Euro.“
Die Agentur schätzt, dass bis 2046 ein Lager für Atommüll betriebsbereit sein könnte. Einige Experten gehen davon aus, dass die Gesamtkosten für den Bau der Anlage bei rund 5,5 Milliarden Euro (6 Milliarden Dollar) liegen.
Erleben die Atomkraft in Deutschland ein Comeback?
Umweltminister Lemke ist der Auffassung, dass die wirtschaftliche Rentabilität ausschlaggebend dafür sei, ob das Land zur Atomkraft zurückkehrt.
„Kein Energieunternehmen wird in Deutschland ein Atomkraftwerk bauen, weil die Kosten zu hoch sind“, sagte Frau Lemke. „Atomkraftwerke können nur mit enormen öffentlichen Subventionen und impliziten Subventionen gebaut werden, darunter teilweise Befreiungen von Versicherungspflichten.“
Derzeit scheint die Atomenergie in Deutschland tatsächlich Geschichte zu sein.
[Anzeige_2]
Quelle


















































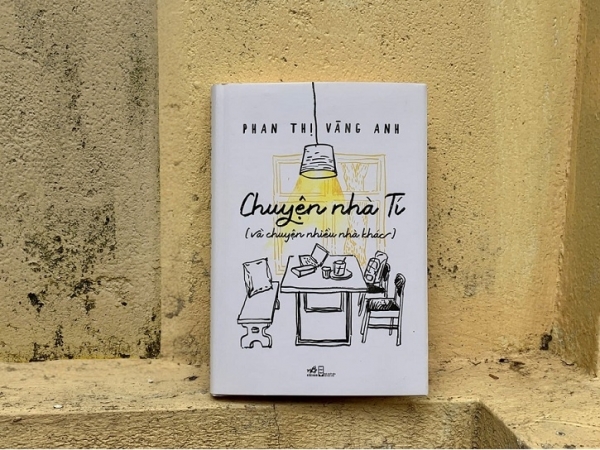













Kommentar (0)