 |
| Illustrationsfoto. |
Im Jahr 2023 kommt die Weltwirtschaft „langsam“ voran. Der Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge wird das globale Wachstum in diesem Jahr auf 3 % sinken (im Vorjahr waren es 3,5 %) und im nächsten Jahr weiter auf 2,9 % sinken, also deutlich unter der durchschnittlichen Wirtschaftswachstumsrate in der Geschichte.
Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist ein weiterer Schlag für ein Land, das sich noch nicht vollständig erholt hat, und macht Volkswirtschaften, die bereits niedriges und ungleichmäßiges Wachstum aufweisen, noch instabiler.
Prekär
Der Präsident der Weltbank (WB), Ajay Banga, warnte, dass die Welt sich in einer „sehr gefährlichen“ Zeit befinde. Alle Konfliktszenarien könnten die Energiepreise auf Rekordhöhen treiben, die Inflation weiter ansteigen lassen und das globale Wirtschaftswachstum verlangsamen. Experten gehen davon aus, dass die Konflikte im Nahen Osten neue Herausforderungen mit sich bringen und die globale Wirtschaftslage noch instabiler machen könnten.
Tatsächlich haben sich die Unruhen im Gazastreifen und der Russland-Ukraine-Konflikt zu den größten Schocks für die Rohstoffmärkte seit den 1970er Jahren entwickelt. Sollte der Konflikt weiter eskalieren, werde die Weltwirtschaft nach Einschätzung des Weltbank-Chefökonomen Indermit Gill zum ersten Mal seit Jahrzehnten mit einem doppelten Energieschock konfrontiert sein, der die Inflation nach den Bemühungen der Zentralbanken, die Geldpolitik zu straffen, erneut anheizen werde.
Die Ölpreise sind seit dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas um 6 Prozent gestiegen, während die Preise für Agrarrohstoffe, Metalle und andere Güter weitgehend unverändert geblieben sind. Auf Grundlage der Geschichte regionaler Konflikte seit den 1970er Jahren prognostiziert der Weltbankbericht drei Szenarien zunehmender Schwere.
In einem optimistischen Szenario könnten die Ölpreise mit ähnlichen Auswirkungen wie die Situation in Libyen im Jahr 2011 um 3 bis 13 Prozent auf 93 bis 102 Dollar pro Barrel steigen.
Wenn das Risiko einer Störung moderat ist, wie etwa beim Irak-Vorfall 2003, könnten die Ölpreise auf 109 bis 121 Dollar pro Barrel steigen.
Im schlimmsten Fall könnten die Ölpreise auf 140 bis 157 Dollar pro Barrel steigen und damit den höchsten Stand seit 2008 übertreffen.
Der Chefökonom des IWF, Pierre-Olivier Gourinchas, sagte, ein Anstieg der Ölpreise um 10 % würde das globale Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr um 0,15 Prozentpunkte verringern, während die Inflation um 0,4 Prozentpunkte steigen würde.
Im World Economic Outlook Report für die zweite Hälfte des Jahres 2023 wies der IWF auf drei Hauptrisiken hin, denen die Welt gegenübersteht: Inflation, Instabilität der Finanzmärkte und die Verflechtung von Geopolitik und Protektionismus.
Das erste Risiko sind hohe Energiepreise aufgrund der Auswirkungen von Konflikten. Dazu gehört das Risiko einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas, bei der möglicherweise auch die engen Beziehungen zwischen dem Iran und der Hamas sowie den USA und Israel eine Rolle spielen, was durchaus zu einer Verknappung des Ölangebots und damit zu einem Anstieg der Energiepreise führen könnte.
Das zweite Risiko ist die Stabilität der Finanzmärkte. In den vergangenen zwei Jahren ist es den Zentralbanken verschiedener Länder nicht gelungen, ihren Plan für langfristige und kontinuierliche Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation umzusetzen. Steigende Schuldenkosten sind eine erwartete Folge der restriktiven Geldpolitik. Hohe Zinssätze können die Anfälligkeit der Finanzmärkte verschärfen und zu mehr Zahlungsausfällen führen.
Neuer Protektionismus?
Als drittes Risiko für die Weltwirtschaft gilt die Verflechtung von Geopolitik und Handelsprotektionismus, die den internationalen Handel und Investitionen behindert. Sie stellt das größte Problem dar und könnte die weitreichendsten Auswirkungen haben.
Der internationale Handel ist der Motor des globalen Wirtschaftswachstums, doch dieser Motor schwächelt. Der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China sowie der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haben multinationale Unternehmen dazu veranlasst, die Geopolitik als eine zu berücksichtigende Variable zu betrachten. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat dazu geführt, dass multinationale Unternehmen der Geopolitik mehr Aufmerksamkeit schenken.
In dem Artikel „Der wahre Feind der Weltwirtschaft ist die Geopolitik, nicht der Protektionismus“ betont der Harvard-Wissenschaftler Dani Rodrik, dass das größte Risiko für die Weltwirtschaft vom Wettbewerb zwischen den beiden führenden Mächten der Welt, den USA und China, ausgehe, der jeden betreffen könne.
Die Analyse des Autors in seinem Artikel ist durchaus passend für die heutige globale Wirtschaft – eine Welt, die instabiler und konfliktanfälliger ist. Die Welt erlebt eine zunehmende Fragmentierung, zunehmende Handels- und Investitionsschranken, eine extreme Form der wirtschaftlichen Korporatisierung und eine andere Form der wirtschaftlichen Globalisierung.
Zwischen China und den USA gab es in letzter Zeit Anzeichen einer Verbesserung der Kontakte, doch der Konflikt zwischen Israel und der Hamas wirkte sich negativ auf den strategischen Wettbewerb zwischen den beiden Ländern aus. Die Geopolitik ist zu einem Schlüsselfaktor geworden, der die globale wirtschaftliche Entwicklung behindert.
Der Handel zwischen den USA und China ist nicht länger ein „Katalysator“ für den Frieden, doch der strategische Wettbewerb zwischen den beiden Giganten verändert die globale Lieferkette.
Der Wirtschaftsprofessor Craig Emerson vertritt die gleiche Ansicht und analysiert in seinem Artikel „Freihandel in einer fragmentierten Welt“, dass die Mittelmächte neue Wege beschreiten, wenn zwei Supermächte um die Vorherrschaft konkurrieren und der Großteil der Welt zum Protektionismus zurückkehrt.
Einige Länder neigen dazu, sich aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen mit der einen oder anderen Supermacht zu verbünden, während andere neutral bleiben.
Im letzten halben Jahrhundert haben große und kleine Länder gleichermaßen vom Prozess der globalen Integration profitiert. Der Trend zur Ausweitung der Wirtschaftsgrenzen und zu einer stärkeren Vernetzung geht davon aus, dass wirtschaftlich voneinander abhängige Länder weniger bereit sind, Konflikte in Erwägung zu ziehen.
Angesichts der Rückkehr des Protektionismus müssen die einheimischen Produzenten nun vor der ausländischen Konkurrenz geschützt werden. Um das Überleben der einheimischen Industrien zu sichern, beginnt ein neuer Prozess der globalen Entkopplung.
Besonders hervorzuheben ist die Aussage von US-Präsident Donald Trump, die er später an seine Nachfolgeregie weitergab, dass Amerika im Wettbewerb mit China wieder groß werden würde, indem es Arbeitsplätze und Industrie ins eigene Land zurückholte. Darüber hinaus unterliegen viele aus anderen Ländern importierte Produkte aus Gründen der nationalen Sicherheit zwangsläufig Beschränkungen oder einer besonderen Zollkategorie.
Unterdessen beharrt China trotz der Kritik westlicher Länder seit langem auf der Umsetzung einer Reihe industriepolitischer Maßnahmen, darunter auch des Handelsprotektionismus.
[Anzeige_2]
Quelle


![[Foto] Preisverleihung für Arbeiten zum Studium und zur Nachfolge von Präsident Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/a08ce9374fa544c292cca22d4424e6c0)



![[Foto] Vietnamesischer Schiffsbau mit dem Anspruch, den Ozean zu erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/24ecf0ba837b4c2a8b73853b45e40aa7)


























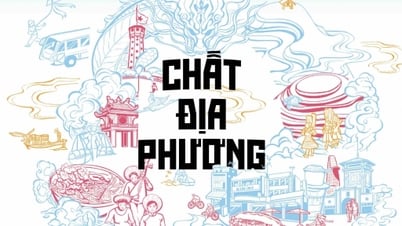
























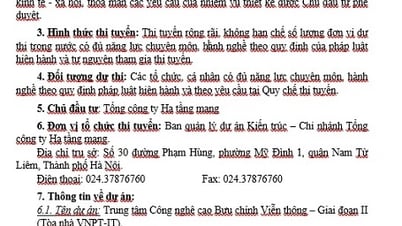














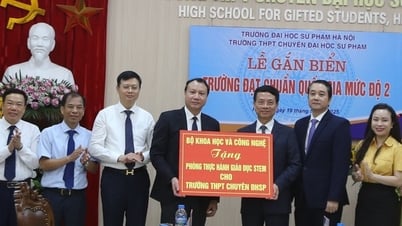




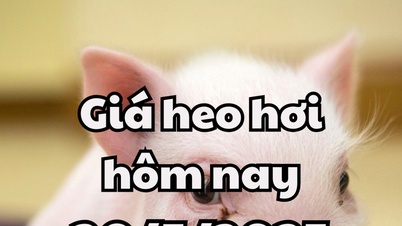
















![[VIDEO] - Steigerung des Werts von Quang Nam OCOP-Produkten durch Handelsbeziehungen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/5be5b5fff1f14914986fad159097a677)
Kommentar (0)